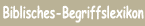DISKUSSION: KIRCHENSTEUER
Was die Kirche ist
Die christlichen Religionsgemeinschaften sollen sich auf ihre Kernaufgaben besinnen
Debatte : Von Gernot Facius
Es scheint, als sei noch einmal alles gut gegangen. Rot-Grün schont die Kirchenkassen.
Das im Zuge der Steuerreform erwartete Minus wird geringer ausfallen als befürchtet.
Von rechts bis links, die PDS eingeschlossen, überschüttet man die Kirchen mit Lob für
ihr soziales Engagement. Ein Grund, dass sich die Kirchenführer entspannt zurücklehnen?
Eher nicht.
Die Streicheleinheiten seitens der Politik müssten eigentlich den Bischöfen, Präsidenten
und Synodalen zu denken geben. Denn die fraktionsübergreifende Wertschätzung gilt
den Kirchen als Sozialagenturen, weniger ihrem prophetischen Dienst an der Welt.
Kirchen sind nützlich, solange sie ihren "unverzichtbaren Beitrag zur Lösung der sozialen
und gesellschaftlichen Aufgaben" leisten. Aber ist das schon alles?
Die Kirchen haben zunächst, sagen wir ruhig:
-
zuallererst das Evangelium zu verkünden, ob gelegen oder ungelegen;!
-
sie haben Gottesdienst zu feiern;
-
sie haben schließlich, weil nach ihrem Verständnis Gottesliebe und Nächstenliebe
eins sind, bedrängten, armen und kranken Menschen beizustehen.
Diese Reihenfolge der "Dienste" ist entscheidend.
Wer allerdings kirchliches Wirken auf Caritas und Diakonie reduziert, ist womöglich ein
guter Sozialpolitiker, weil er die staatlichen Kassen schont.
Doch er ignoriert den ureigentlichen Auftrag der Kirche.
Und die "Nützlichkeit" wird von der Politik her ohnehin schnell relativiert,
wenn sich die Kirche zu unbequemen Fragen wie Lebensschutz oder Ehe und Familie äußert.
Da erscheint sie, siehe ihr Eintreten wider die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften,
eher als gesellschaftlicher Störenfried. Hohn und Spott werden über sie ausgeschüttet.
Keine Frage: Wer wie die Kirchen soziale Leistungen erbringt, dem muss natürlich mit öffentlichen Mitteln geholfen werden.
Aber das Argument, dass man der Kirche Geld gibt, weil sie bestimmte soziale Aufgaben erfüllt,
ist "zweischneidig", wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann,
einräumt:
"Dies kann morgen unter Umständen aufgelöst werden."
Er will eine prekäre Abhängigkeit vom Staat nicht leugnen, sind doch die Kirchen bei der
deutschen Steuergesetzgebung auf das "politische Geschäft angewiesen" (Lehmann).
Die Kirchensteuer ist in Deutschland weiter an die Einkommensteuer gebunden,
mithin an der persönlichen Leistungskraft ausgerichtet, obwohl europaweit der
steuerpolitische Zug längst in eine andere Richtung fährt: weg von direkten und hin zu
indirekten Steuern.
Das führt dazu, dass beispielsweise in einer Großstadt wie Braunschweig - Tagungsort
der diesjährigen Synode der EKD - von den 88 000 evangelischen Kirchenmitgliedern nur
rund 27 000 Kirchensteuern bezahlen.
Ähnlich sieht das in anderen Regionen aus. Nur gut 40 Prozent der deutschen Katholiken
zahlen Lohn- oder Einkommensteuer und werden somit zur Kirchensteuer herangezogen.
Die demographische Entwicklung, gepaart mit einer anhaltenden Austrittsbewegung und
einer Frühverrentung, wird diesen Negativtrend noch beschleunigen.
Ob die Kirchenleitungen es wollen oder nicht - es wird über Alternativen zum bisherigen
System der Kirchensteuer, vielleicht sogar auch über die Nützlichkeit dieser Steuer
in unserer Zeit diskutiert werden müssen, wenn nicht eines Tages das gesamte Gebäude
einstürzen soll.
Die Kirchensteuer zur Disposition zu stellen gilt weithin als Sakrileg;
heilige Kühe schlachtet man nicht. Dabei ist diese Steuer, wie alle anderen Systeme
der Kirchenfinanzierung, theologisch nicht zwingend geboten.Im Gesetzbuch der
katholischen Kirche von 1983 ist lediglich von einer Grundpflicht aller Gläubigen die Rede,
ihre Kirche materiell so zu unterstützen, dass sie ihre Aufgaben erfüllen kann.
"Eine Kirche kann nur gesund sein, wenn sie aus freiwilligen Gaben der
Gemeindemitglieder lebt."
Dieses Diktum des Erfurter evangelischen Propstes Heino Falcke aus dem Vereinigungsjahr
1990 ist typisch für das idealistische Denken von Geistlichen, die sich vom Konzept der
Volkskirche verabschiedet haben.
Selbst die Minderheitskirche in der DDR war nicht lebensfähig ohne die materiellen
Hilfen aus Deutschland-West. Diese wiederum verdankten sich der Kirchensteuer als stabiler
Einnahmequelle.
Dennoch müssen die Protagonisten der Freiwilligkeit ja nicht völlig Unrecht haben.
Längerfristig wird die durch den Staat eingezogene Kirchensteuer die Basis sein,
für alles andere werden die Gläubigen - auch die, die nicht im Erwerbsleben stehen -
aufzukommen haben.
Erst dann wird man erfahren, wie fest das Fundament der Kirchen ist.
Schon jetzt sollten sie sich deshalb fragen: Müssen wir unbedingt alles an Aufgaben
behalten, was uns zugewachsen ist? Entspricht alles, was wir tun, wirklich unserem
geistlichen Auftrag?
Was ist heute noch das Besondere an Krankenhäusern in kirchlicher Trägerschaft?
Die schlagzeilenträchtige Affäre Dörfert, die schlimmen Vorgänge um die Trierer
Caritas-Trägergesellschaft, über die zurzeit in Koblenz zu Gericht gesessen wird,
haben ihre Wurzeln in einem Erhaltungs- und Expansionswahn,
der nicht mehr mit karitativer Sorge entschuldigt werden kann. Und was die Zukunft
des deutschen Kirchensteuersystems betrifft:
Es steht und fällt mit der Art, wie die Kirchen mit dem Geld ihrer Mitglieder umgehen
und wie offen sie darüber Rechenschaft ablegen.
Das heißt aber auch: Konzentration auf das Wesentliche - auf das, was Kirche ausmacht.
(c) Die WELT online welt.de
Stand: 14.11.00
Siehe auch:
Der Nächste
|
|